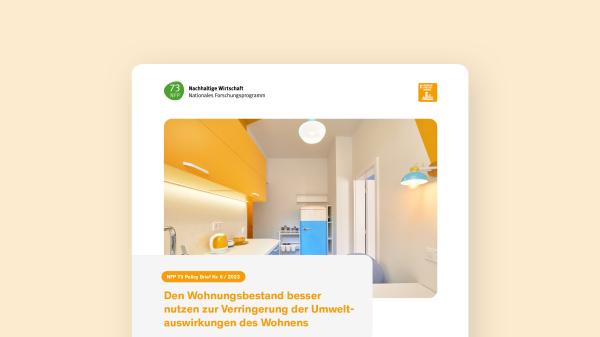Wohnen und Bauen
Der ökologische Fussabdruck von Wohnbauten verringert sich, wenn sich (i) die Nachfrage nach Wohnraum und (ii) der Material- und Energieverbrauch im Lebenszyklus von Wohngebäuden verändert. Beim Co-Creation Lab (CCL) «Nachhaltiges Wohnen und Bauen» wurden diese beiden Aspekte kombiniert und über 70 Fachpersonen in Workshops und Interviews einbezogen.

Hintergrund
Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher, und steigende Energiepreise und Versorgungsengpässe bei Energie und Baumaterialien zeigen, dass unsere Wirtschaftssysteme Schwachpunkte aufweisen. Die Wohnungsknappheit steht derzeit weit oben auf der politischen Agenda der Schweiz.
Das CCL präsentiert eine Vision für nachhaltiges Bauen und Wohnen: gesunde Wohnsiedlungen, die für Bau und Unterhalt ohne fossile Brennstoffe auskommen, ausschliesslich sekundäre Ressourcen verwenden und ausreichend bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen bieten.
Ziel
Das CCL will einen Beitrag dazu leisten, die Lücke zwischen der heutigen Situation und dieser Vision zu schliessen und den Transitionsprozess voranzutreiben. Es stellt dazu Wissen bereit und bietet einen Ort für Debatten, gegenseitiges Lernen und kreatives Denken. Der Schwerpunkt liegt auf Themen, bei denen das Forschungsteam Erfolge in der wissenschaftlichen und angewandten Forschung vorweisen kann – insbesondere, aber nicht nur im Rahmen des NFP 73. Ziel ist es, (i) den Stakeholdern und interessierten Organisationen Orientierungshilfen zu geben und (ii) dazu beizutragen, eine Agenda festzulegen und den Weg für konkrete Massnahmen zu bereiten.
Resultate
Dieses Zusammenarbeitsprojekt hat gezeigt, dass der Transitionsprozess hin zu nachhaltigem Wohnen und Bauen sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot ansetzen muss. Dabei sollte der Schwerpunkt darauf liegen,
-
eine Trendumkehr bei der steigenden Pro-Kopf-Nachfrage nach Wohnraum herbeizuführen (Nachfrageseite) und
-
die Energie- und Materialeffizienz beim Betrieb und Bau von Gebäuden zu verbessern (Angebotsseite).
Materialkreisläufe im Bauwesen
Strategien zur Beeinflussung der Nachfrage sind zentral, da in der Schweiz bis 2050 ein Bevölkerungswachstum von ca. 20 % erwartet und der Anteil älterer Menschen (über 65 Jahre) zunehmen wird. Dennoch können wir unsere Klimaziele bis 2050 erreichen, wenn wir alle Möglichkeiten zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen nutzen. Hingegen werden wir die Materialkreisläufe im Bauwesen bis 2050 nicht schliessen können, da wir weiterhin Infrastrukturen zur Versorgung einer wachsenden Bevölkerung bauen werden. Die Umstellung ist nur realisierbar, wenn alle beteiligten Akteure darauf hinwirken: Industrie (Energieversorgung, Baumaterialien, Bauwesen, Immobilienbranche, Finanzdienstleistungen), Behörden (Gemeinden, Kantone, Bund), Planung (Architektur- und Ingenieurbüros) und die Haushalte (Gebäudeeigentümer:innen und Mieter:innen). Die Zusammenarbeit sollte auf gemeinsame Lernprozesse ausgerichtet sein, die Innovationen fördern und dazu beitragen, Risiken zu managen und zu teilen. Wir sind davon überzeugt, dass in verschiedenen Bereichen gleichzeitig dringender Handlungsbedarf besteht:
Anstossen von Transformationsprozessen mit langfristigem Zeithorizont:
-
Waldbewirtschaftung zur Steigerung der Produktion von Bauholz und
-
Design/Entwicklung von kreislauffähigen Gebäuden, Komponenten und Materialien für Demontage, Wiederverwendung und Recycling.
Beschleunigen der bereits laufenden Transformationsprozesse:
-
Ersatz fossiler Brennstoffe für die Energieversorgung von Gebäuden und bei der Herstellung von Baumaterialien und
-
Erhöhung des Anteils von Materialien aus Biomasse (z. B. Holz) sowie von wiederverwendetem/recyceltem Material.
Förderung von sozialen Innovationen und institutioneller Entwicklung
Die Rolle dieser Faktoren im Transformationsprozess ist noch nicht genügend anerkannt. Sie könnten
-
die Wohnmobilität der Haushalte erhöhen und
-
die Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen zwischen den Akteuren im Planungsprozess (Bauherrschaft, Architektur- und Ingenieurbüros, Bauunternehmen, Materialhersteller usw.) sowie zwischen verschiedenen Fachleuten im Wohnungs- und Bauwesen fördern.
Bedeutung für die Forschung
Das CCL zeigt, wie das Konzept des Transitionsmanagements zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Forschungsteams und Interessengruppen angewendet werden kann. Das Konzept beruht auf gegenseitigem Lernen, dem Festlegen einer gemeinsamen Agenda und Folgeprojekten, die als Transitionsexperimente eine Mitentwicklung (Co-Creation) aller Stakeholder im Wohnungs- und Bauwesen fördern. Damit konnten relevante Forschungsfragen in verschiedenen Bereichen definiert und die Forschenden ermutigt werden, zum geplanten Transitionsprozess beizutragen und unterstützendes Wissen bereitzustellen.
Bedeutung für die Praxis
Das CCL empfiehlt Transitionsstrategien: Die öffentliche Politik sollte sich auf die effiziente Nutzung von bebauten Wohngebieten konzentrieren und unter Einbezug der Akteure im Immobiliensektor und der Gesellschaft die Wohnmobilität fördern. Auf der Angebotsseite sollte die Politik den Ersatz fossiler Brennstoffe zur Energieversorgung von Gebäuden und zur Herstellung von Baumaterialien dezidiert fördern. Staatliche Akteure und die Industrie sollten darauf hinwirken, dass mehr Baumaterialien aus Biomasse produziert und Materialien wiederverwendet oder recycelt werden und dass beim Design auf die Eignung zur Demontage und für das Recycling geachtet wird. Das Ziel ist dabei, die Kreislaufwirtschaft in diesem Sektor zu stärken, auf den gewichtsmässig über 70 % des gesamten Materialverbrauchs entfallen.