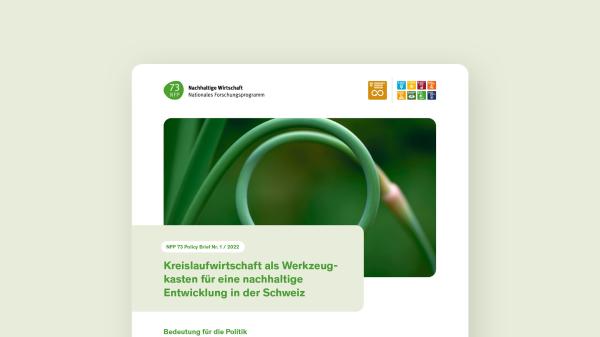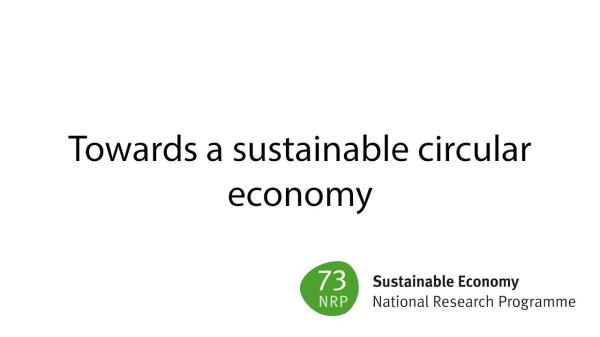Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
Im Projekt «Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft» (TACLE) wurde ein Materialflussansatz mit einer Unternehmens- und einer Politikperspektive kombiniert. Das Hauptziel bestand darin, das verborgene Potenzial für ein besseres Ressourcenmanagement in der Schweiz zu bestimmen und den Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu ebnen.
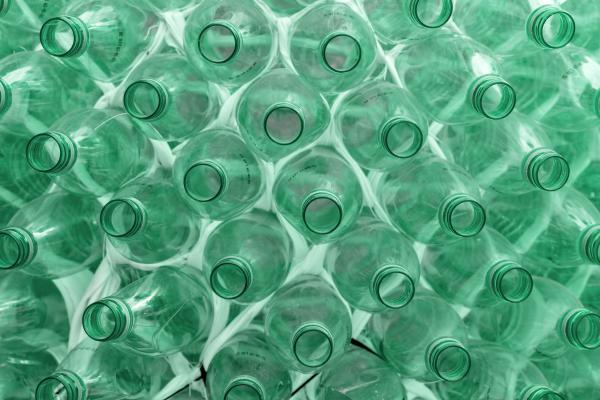
Hintergrund
Aufgrund der wachsenden Bevölkerung und neuer Konsummuster hat sich der Druck auf die natürlichen Ressourcen weltweit verstärkt. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft wird in Politik, Wirtschaft und Forschung immer häufiger als Mittel zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen. Es bestehen jedoch wesentliche Wissenslücken bei der Umsetzung und den Auswirkungen einer Kreislaufwirtschaft und mit diesem Projekt sollten diese Lücken untersucht werden.
Ziel
Ziel des Projekts war es, (i) Möglichkeiten zu bestimmen und zu quantifizieren, mit denen die Ressourceneffizienz in der Schweizer Industrie durch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft optimiert werden kann; (ii) zu analysieren, wie Unternehmen Wertschöpfungsketten in Richtung einer Kreislaufwirtschaft aufbauen bzw. umgestalten können und (iii) Politik und Industrie beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Die übergeordnete Forschungsfrage des Projekts lautete: Wo besteht verstecktes Potenzial zur Verbesserung des Ressourcenmanagements in der Schweiz und wie lässt sich dieses für die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft nutzen?
Resultate
Fallstudien zeigen eine Verbesserung der Schweizer Wirtschaft
Wir haben bestimmt und quantifiziert, wie sich die Ressourceneffizienz in der Schweizer Wirtschaft durch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft verbessern lässt, sowohl mit Blick auf Ressourcen als auch aus sozioökonomischer Sicht. Dazu wurden auch neue Indikatoren zur Messung der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Fallstudien zu Wärmedämmung, Möbeln, Textilbekleidung und Kunststoffen wurden ökologisch ausgewertet und, mit Ausnahme der Textilien, auch aus sozioökonomischer Sicht analysiert.
Verminderung von Umweltauswirkungen in verschiedenen Industrien
Die Ergebnisse zeigen, dass in der Wärmedämmungsindustrie die Umsetzung von Kreislaufstrategien durch Ansätze wie Vermindern und Recycling das grösste Umsetzungspotenzial haben, sowohl was die Kosten als auch die Ressourcen betrifft. Im Fall von Möbeln erwiesen sich interne und externe Faktoren wie die Modularität des Möbeldesigns bzw. die Transportdistanz für die Wiederverwendung/Restaurierung als zentral für eine erfolgreiche Umstellung in Möbelunternehmen. Das Restaurieren von Möbeln, einschliesslich Rücknahmesystem, und das Flicken von Kleidern zeigten das grösste Potenzial zur Verminderung von Umweltauswirkungen. Ausserdem stellten wir fest, dass Rebound-Effekte (d.h. das gesparte Geld wird für andere Waren oder Leistungen ausgegeben) die positive Wirkung des reduzierten Konsums oder die längere Nutzung von Kleidern oder Möbeln schmälern können. Eine Untersuchung der Kunststoffverpackungsindustrie ergab, dass die Politik das gesamte Spektrum von Regulierungslösungen zum Abbau von Hürden für die Kreislaufwirtschaft kennen muss und dass sie verstehen sollte, welche Auswirkungen für die verschiedenen Beteiligten damit verbunden sind. Nur so kann die Politik auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft hinwirken.
Innovationen und organisatorische Aspekte auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft
Die Analyse des Aufbaus und der Neuausrichtung von Wertschöpfungsketten hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zeigte, dass disruptive Kreislauf-Innovationen – zum Beispiel ein Konzept für die Demontage im Bausektor oder ein enzymatisches Recycling für Kunststoffe und Textilien – durch Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie organisatorische Aspekte (Interdependenzen zwischen Stakeholdern, gemeinsame Neukonzeption der etablierten Wertschöpfungskette).
Wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte
Insgesamt ist es für die Politik entscheidend, bei der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft auch wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte ausreichend zu berücksichtigen – neben dem konzeptionellen Kriterium der Zirkularität von Materialien, die angibt, welcher Anteil der Materialien im geschlossenen Kreislauf zirkuliert.
Bedeutung für die Forschung
Mit dem Projekt wurden wichtige theoretische und methodische Erkenntnisse gewonnen. Konkret entwickelten wir einen Rahmen zur ökologischen Evaluation von Strategien für die Kreislaufwirtschaft sowie ökologische und ökonomische Indikatoren, zudem haben wir zur Diskussion über Nachhaltigkeitsaspekte in diesem Bereich beigetragen. Schliesslich trugen unsere Erkenntnisse über die Hindernisse auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft und die Analyse von Wertschöpfungsketten zu einem besseren Verständnis der Rolle von Unternehmen und der Bedeutung der Politik bei dieser Umstellung bei.
Bedeutung für die Praxis
Der entwickelte ökologische und ökonomische Evaluationsrahmen und die Erkenntnisse aus der Fallstudie bieten eine wissenschaftliche Grundlage für (i) die Politik, indem ökologische und ökonomische Hotspots in bestimmten Wertschöpfungsketten und Hürden für die Kreislaufwirtschaft aufgezeigt werden und (ii) die Industrie, indem Möglichkeiten zur Schliessung von Lücken in Stoffkreisläufen und die daraus resultierenden ökologischen und ökonomischen Umsetzungspotenziale dargestellt und bewertet werden. Der entwickelte Umweltindikator – Retained Environmental Value (REV) – wurde ins Zielsystem von Swiss Recycling integriert. Aufgrund eines im Bundesparlament eingereichten Postulats wird derzeit vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) eine landesweite Einführung geprüft.
Publikationen
Projektleitung
Prof. Dr. Volker Hoffmann
Group for Sustainability & Technology, ETH Zürich
Prof. Dr. Stefanie Hellweg
Institut für Umweltingenieurwissenschaften, ETH Zürich
Projektpartner
Denner AG
Empa
Eberhard Unternehmungen
Flumroc AG
Swisspor AG